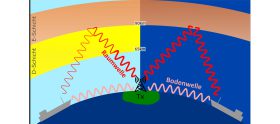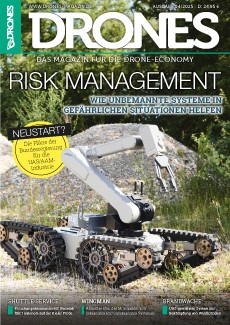Wertvolle Hilfe
Fördermittel können für Unternehmen den Durchbruch bedeuten. Und entgegen landläufiger Meinungen sind sie weder Hexenwerk noch Mythos. Im Gegenteil. Man könnte die deutsche Förderlandschaft sogar mit einem reichhaltigen Buffet vergleichen: Vielfältig, überwältigend – und ein bisschen unübersichtlich. Doch ein genauerer Blick kann sich lohnen. Denn geeignete Subventionen wirken wie ein Zaubertrank für Wachstum und technologischen Fortschritt.
Von Sabine Hentschel
Im Bereich Luftfahrt denkt man beim Thema Förderungen in erster Linie an komplette Neuentwicklungen von bemannten oder auch unbemannten Flugsystemen. Dabei sind jedoch auch andere innovative Neuentwicklungen förderfähig. Beispielsweise wenn es darum geht, Materialien, Antriebssysteme oder einzelne Komponenten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sicherheit, Miniaturisierung oder diagnostische Performance zu optimieren. Gleiches gilt auch für die Erforschung verbesserter Herstellungsverfahren. Höchste Zeit also, einigen hartnäckigen Vorurteilen rund um das Thema Fördermittel mit Fakten zu begegnen.
Fakt 1: Fördermittel sind nicht nur für die Big Player
Mehr als 3.000 Programme in Deutschland richten sich direkt an kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Start-ups. Über 90 % der Förderungen sind auf Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden ausgerichtet. Im Klartext: Besonders die Kleinen können groß abräumen, wenn es um Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Technologien und Dienstleistungen geht.
Fakt 2: Förderungen gibt es für nahezu alle Branchen
Von Bund und Ländern gibt es zwar spezielle Programme, die auf einzelne Technologiefelder wie Luftfahrt, Maschinenbau, Automotive, Robotik, Medizintechnik, Mikroelektronik oder dergleichen beschränkt sind. Daneben gibt es aber auch branchenoffene Instrumente der Forschungs- und Innovationsförderung. So ist zum Beispiel die Forschungszulage grundsätzlich für alle im Sinne des Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetzes in Deutschland steuerpflichtigen Unternehmen zugänglich. Unabhängig von Unternehmensgröße und Branchenzugehörigkeit – und das sogar bis zu vier Jahre rückwirkend.

Sollen Fördermittel zur Finanzierung eines Projektes herangezogen werden, ist dies bereits in einem frühen Planungsstadium zu berücksichtigen, um zeitlich effizient agieren zu können
Fakt 3: Es gibt Landkarten für den Förderdschungel
Die Webseite der Bundesregierung (www.foerderinfo.bund.de) und die Förderdatenbank des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (www.foerderdatenbank.de) sind hilfreiche Tools, um angesichts des reichhaltigen Angebots nicht den Überblick zu verlieren. Sie bieten einen gut strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Zugriff auf Tausende von Programmen und helfen dabei, die passende Nadel im Heuhaufen zu finden.
Fakt 4: Förderung muss keine einmalige Sache sein
Unternehmen können mehrere Projekte zu unterschiedlichen Themen parallel fördern lassen, solange sie sich klar voneinander abgrenzen. Für smarte Unternehmen ist der Posten „Fördermittel“ also ein Dauergast im Budgetplan und ein zusätzlicher Booster auf der finanziellen Überholspur.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgelegte „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand“ ist das wohl bekannteste Förderinstrument für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland
Fakt 5: Antrag (fast) immer vor Projektbeginn stellen
Nur im Rahmen der Forschungszulage können Unternehmen erstmals rückwirkend eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung oder externe Forschungsaufträge fördern lassen, solange diese nach dem 01. Januar 2020 gestartet wurden. Für alle anderen Programme gilt: Der Antrag muss immer vor dem Projektbeginn gestellt werden. Für den Start gibt es dann zwei Varianten: Entweder man darf mit dem Tag der Antragstellung auf eigenes Risiko starten oder erst mit der Bewilligung beziehungsweise der sogenannten Erteilung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Dieser Punkt ist dringend vor dem Beginn der Arbeiten abzuklären, denn ein zu früher Start kann den Förderzauber sonst schnell verpuffen lassen.
Fakt 6: Scheitern ist erlaubt
Forschung und Entwicklung zeichnen sich durch eine Unsicherheit hinsichtlich des Endergebnisses aus. Daher bedeutet ein gescheitertes Projekt nicht gleich das Ende der Förderung.

Ohne Fleiß, kein Preis. Wer die Möglichkeiten nutzen möchte, die Fördermittel bieten, muss sich intensiv mit ihnen befassen
Der erste Fördermittelantrag fühlt sich vielleicht noch an wie ein Marathon in Gummistiefeln. Nach dem dritten oder vierten stellt sich jedoch eine gewisse Routine ein, da viele Antragsverfahren ähnlich aufgebaut sind. Alternativ kann man – gegebenenfalls auch nur für die ersten Schritte durch den Förderdschungel – die Dienste spezieller Fördermittelberaterinnen und -berater in Anspruch nehmen. Das kostet zwar Geld, das mit Blick auf die positiven Effekte von Fördermitteln jedoch gut investiert sein kann.
Info
Die ZIM-Förderung (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) ist gewissermaßen der Popstar unter den Förderprogrammen. Damit lassen sich die Entwicklung neuer oder signifikant verbesserter Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen fördern.
Das Instrument KMU-innovativ ermöglicht eine Förderung für besonders innovative Projekte kleiner und mittlerer Unternehmen.
Horizont Europa ist das größte Forschungs- und Innovationsförderprogramm der EU. Damit stellt die Europäische Union bedeutende Mittel zur Verfügung, um die internationale Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung zu fördern.
Die sogenannte Forschungszulage ist eine steuerliche Begünstigung für Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Durch die Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes im März dieses Jahres wurden die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Forschungszulage noch einmal attraktiver. Bisher war diese bis 2026 zeitlich begrenzt – mit der Gesetzesänderung gilt sie nun unbefristet. Kleine und mittelständische Unternehmen können künftig eine Erhöhung der Forschungszulage um 10 Prozentpunkte beantragen. Das heißt, dass die Förderung von 25 auf 35 Prozent der Bemessungsgrundlage – also der förderfähigen Projektkosten – ansteigt. Zudem wurde unter anderem auch die Bemessungsgrundlage von bisher 4 auf 10 Millionen Euro angehoben, sodass die maximale Förderung von 1 auf 3,5 Millionen Euro jährlich steigt.
Fotos: LangnerRT, Alina Tymofieieva, kunakorn, nmann77 – stock.adobe.com