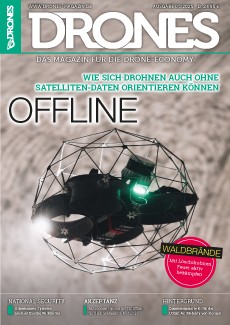Komponenten des BALIS-Testsystems erreichen erstmals Megawatt-Grenze
Im Projekt BALIS baut das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein einzigartiges wissenschaftliches Testfeld auf, um die Komponenten von auf Brennstoffzellen-basierten elektrischen Antrieben für mobile Anwendungen mit einer Leistung von bis zu 1,5 Megawatt zu entwickeln und zu testen. Zum ersten Mal ist es den Forschenden dabei gelungen, mit zwei der wichtigsten Komponenten – den Brennstoffzellen und dem Elektromotor – jeweils eine Leistung von mehr als einem Megawatt zu erreichen.

Meilenstein in der Entwicklung von Brennstoffzellen-Systemen der nächsten Generation
„Das ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau und bei der Inbetriebnahme des Testfelds und der ersten Generation des Brennstoffzellen-Testsystems“, erklärt die Projektleiterin Dr. Cornelie Bänsch vom DLR-Institut für Technische Thermodynamik. Bisher sind Systeme dieser Leistungsklasse nicht auf dem Markt erhältlich. Die technische Herausforderung liegt darin, alle Komponenten so zu entwickeln und zusammenzubringen, dass sie stabil mit einer hohen Leistung von einem Megawatt und mehr laufen: Dazu koppeln die DLR-Forschenden insgesamt zwölf Brennstoffzellen-Module elektrisch miteinander. Alle Module tauschen Informationen aus und interagieren. Jedes dieser Module besteht wiederum aus mehr als 400 einzelnen Brennstoffzellen.
„Um diesen komplexen Aufbau zu steuern, entwickeln wir ausgefeilte Betriebsstrategien. Damit wollen wir schrittweise das Testsystem immer länger stabil betreiben und die Leistung noch weiter über ein Megawatt steigern. Sobald das funktioniert, fahren wir auch dynamische Profile. Darunter versteht man den Betrieb bei unterschiedlichen, hohen Leistungen für unterschiedlich lange Zeiträume, also Bedingungen wie sie in praktischen Anwendungen vorkommen“, fasst DLR-Forscherin Bänsch zusammen.
Antriebsstränge für mobile, leistungsintensive Anwendungen ermöglichen
Brennstoffzellen-Systeme, wie sie das DLR mit BALIS entwickelt und testet, könnten zukünftig zum Beispiel Schiffe antreiben, im Schwerlastverkehr auf der Straße oder in der Luftfahrt eingesetzt werden. Kommt in den Brennstoffzellen Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen – sogenannter grüner Wasserstoff – zum Einsatz, ermöglichen sie CO2-freie und damit klima- und umweltverträgliche Mobilität. Gleichzeitig ermöglicht diese Technologie, unabhängiger von fossilen Rohstoffen zu werden und die Innovationsstärke und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie im Hightech-Bereich zu stärken.
Das komplexe und modular aufgebaute BALIS-Testfeld ermöglicht es, einzelne Komponenten und auch ganze Antriebsstränge – zum Beispiel gemeinsam mit Luftfahrtforschungsinstituten im Antriebsbereich – umfassend zu untersuchen. Aufgrund der Größenordnung, des flexiblen Aufbaus und der damit verknüpften Forschungsmethodik ist die Anlage weltweit einmalig. Sie befindet sich auf dem Innovationscampus des E2U Empfinger Entwicklungszentrum für Umwelttechnologie.
Finanzierung und Koordination des Projekts BALIS:
Die Untersuchungen werden im Projekt BALIS 2.0 durchgeführt und im Rahmen des „Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ mit insgesamt 9,3 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.
Im Drones PR-Portal erscheinen Nachrichten und Meldungen von Unternehmen aus der Drone-Economy. Für die Inhalte der Pressemitteilungen sind die jeweiligen Unternehmen verantwortlich.